Vorhofflimmern und Schlaganfall - das Risiko richtig einschätzen
Kanadische Studie untersucht das Risiko auf einen Schlaganfall in Abhängigkeit vom tatsächlichen Flimmern
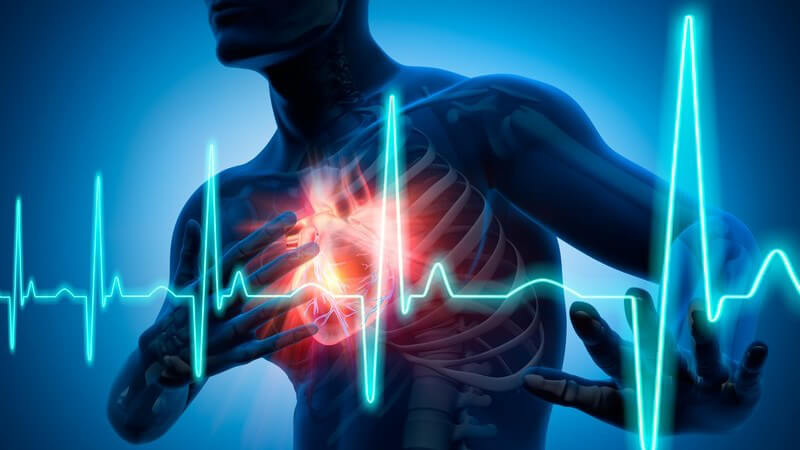
Zahlreiche Studien haben bereits gezeigt, dass ein Vorhofflimmern nicht selten der Vorbote eines Schlaganfalls ist. Die Herzrhythmus-Störung darf daher auch nicht auf die leichte Schulter genommen werden.
Allerdings bedeutet die erhöhte Gefahr nicht, dass ein Schlaganfall in jedem Fall die Folge sein wird.
Drei Herzrhythmus-Störungsarten
Der Begriff Vorhofflimmern ist ein Sammelbegriff für insgesamt drei Herzrhythmus-Störungen. Daher kommt es darauf an, welches Problem im Detail vorliegt, damit man das Risiko realistisch einschätzen kann.
Eingeteilt wird das Flimmern nach dem Kriterium der Dauer.
- Das "paroxysmale Vorhofflimmern" kommt innerhalb von einer Woche immer einmal wieder vor, allerdings nie länger als 48 Stunden anhält.
- Jedes Flimmern, das über zwei Tage andauert, wird "persistierendes Vorhofflimmern" genannt.
- Darüber steht die dritte Stufe des chronischen Flimmerns, auch als "permanentes Vorhofflimmern" bezeichnet.
Studie mit 6.500 Patienten
Da ältere Studien bei der Ermittlung des Schlaganfallrisikos nie genau unterschieden haben, welches Flimmern vorlag, kann das reale Risiko in der Praxis also gar nicht so genau eingeschätzt werden. Dies wollten kanadische Forscher ändern und untersuchten in ihrer Studie das Risiko auf einen Schlaganfall in Abhängigkeit vom tatsächlichen Flimmern.
Die Arbeit mit 6.500 Freiwilligen konnte dabei auf deutliche Unterschiede. Bei allen wurde der Herzrhythmus für mehrere Monate mittels Implantat überwacht.
Gleichzeitig wurde dokumentiert, wer einen Schlaganfall erlitt. Die Quote für die Hirninfarkte pro Jahr stieg mit der Dauer des Vorhofflimmerns.
Ergebnisse der Studie
Das Ergebnis: Sie lag
- bei paroxysmalen Flimmern bei 2,1 Prozent
- bei persistierenden Flimmern bei drei Prozent und
- beim permanenten Flimmern bei 4,2 Prozent.
Das Risiko kann sich also innerhalb der Gruppe dieser Herzrhythmus-Störung verdoppeln.
Die Forscher haben damit gezeigt, dass die Unterscheidung wichtig ist und Ärzte können das tatsächliche Risiko ihrer Patienten dank dieses Hintergrundwissens künftig besser bewerten. Medikamente zur Hemmung der Blutgerinnung (Antikoagulation) sind bei geringem Schlaganfallrisiko eventuell gar nicht nötig.
Passend zum Thema
- Mit dem Kryoballon gegen Vorhofflimmern: Neue Generation erfolgreich getestet
- Betablocker helfen bei Herzinsuffizienz, nützen aber nichts bei Herzinsuffizienz plus Vorhofflimmern
- Schau mir in die Augen: Ärzte erkennen Vorhofflimmern schon beim Blick ins Gesicht
- Vorhofflimmern ist ein Risikofaktor für Schlaganfall, Herzinfarkt und Nierenversagen